Die letzten Tage und Stunden waren hektisch. Hab ich alles dabei? Mama nochmal anrufen? Schaltung nochmal einstellen? Seltsamerweise bin ich jetzt am Start des 24-Stunden-Rennens Kelheim ganz ruhig. Kurz zuvor rauschte ein kurzer Schauer vom Himmel, die Straße ist nass und dampft beinahe. Der beste Mann der Welt, der für die nächsten 24 Stunden der beste Betreuer der Welt sein wird, zupft nervös an mir herum. Um mich herum herrscht aufgeregt-fröhliche Betriebsamkeit. Startnummer richtig festmachen, fachsimpeln, Glück wünschen.
Egal, ob Rad am Ring, München Olympiapark oder Kelheim. Egal, ob Rennrad oder Mountainbike – ein Rennen über 24 Stunden ist etwas ganz Besonderes. Vor allem, wenn man sich für die Solo-Variante entscheidet. Die 24 Stunden von Kelheim kenne ich schon von früheren Ausgaben, noch als Betreuerin. Familiäre Atmosphäre, viele bekannte Gesichter, wunderschöne Strecke – kein Zweifel, wenn ich mich selbst an den 24 Stunden versuchen will, dann hier.
Ein bisschen doof muss man schon sein, um sowas zu machen, da sind sich die meisten einig. Aber jetzt, kurz vor dem Start in Kelheim, kommt es mir eigentlich gar nicht mehr so doof vor. Meine Beine fühlen sich gut an, ich habe die letzten Nächte gut geschlafen und bin mental darauf vorbereitet, bis morgen Mittag hauptsächlich zwei Dinge zu tun: treten und essen. Ach ja, und einschmieren – vermutlich bin ich die einzige Teilnehmerin mit Sonnencreme in der Trikottasche.

Um 14 Uhr dann der Countdown. Drei, zwei, eins. Knall! Die Spitze rast los, der Bergwertung entgegen. Die vielen Zuschauer jubeln. Weiter hinten im Starterfeld, da wo ich stehe, fällt der Beginn gemütlicher aus. Um mich herum rasten zahlreiche Schuhplatten in die Pedale ein und das große Feld setzt sich langsam in Bewegung. Die große Überraschung: An vielen Stellen höre ich meinen Namen, blicke in viele bekannte Gesichter und freue mich wie Bolle über die unerwartete Unterstützung.
Die Strecke hat es in sich
Die Strecke, die ich dann die nächsten Stunden hoffentlich ein paar Mal umrunde, hat es in sich. 16,3 Kilometer und 180 Höhenmeter. Bereits kurz nach dem Start beginnt der „Spaß“: Die Straße steigt zunächst moderat an, nach wenigen hundert Metern geht es dann schon knackiger auf zwei Serpentinen zu. Nachdem die geschafft sind, tut es noch ein bisschen weh, bis die Abzweigung zur Befreiungshalle auf der linken Seite auftaucht. Den Rest der Steigung rollt man im Vergleich zu vorher locker hinauf und kann danach die Beine während einer kurzen Abfahrt nach dem ersten, etwa zwei Kilometer langen, Anstieg etwas lockern. Das ist auch nötig, denn nach einer Rechtskurve tut sich das Highlight der Strecke vor einem auf, der gefürchtete „Col de Stausacker“.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.strava.com zu laden.
Etwa einen Kilometer zieht sich der Stausacker Berg schnurgerade dahin und tut mit bis zu 10 Steigungsprozenten noch einmal richtig weh. Erst ganz oben, wenn der aufblasbare „Sport2000“ Zielbogen zu sehen ist, lässt der Schmerz etwas nach. Was dann kommt, ist eine Wohltat: Die nächsten vier Kilometer darf man nämlich die Höhenmeter, die zuvor erklommen wurden, wieder nach unten rollen. Die Bremsen muss man nur einmal vor einer 90° Kurve anfassen, ansonsten kann man es bedenkenlos krachen lassen. Für die letzten sechs Kilometer zurück nach Kelheim ist es von Vorteil, sich einer Gruppe anzuschließen, denn hier geht es weitgehend flach dahin.
Nach der Fahrt auf der Bundesstraße türmt sich als letztes „Hindernis“ die Altmühlbrücke vor den Fahrern auf. Kurz darauf wird man in der Kelheimer Altstadt, in der Wechselzone und Zeitnahme aufgebaut sind, auf dem Kopfsteinpflaster ordentlich durchgerüttelt und im Festzelt enthusiastisch angefeuert.
Durchhalten ist alles
Die ersten Runden fühle ich mich großartig und die Kilometer fliegen nur so vorüber. Ich liege weit unter meinem angepeilten Schnitt von 45 Minuten pro Runde und überhole am Berg zahlreiche Sportler, die ich deutlich fitter einschätzen würde als mich. Etwas irritiert bin ich hin und wieder in der Wechselzone, wenn mich der Moderator als nur auf dem zehnten Platz liegend ankündigt. Da wird mir klar: Es sind zwar nur zwölf Mädels als Einzelfahrerinnen am Start, aber die meinen es alle ernst! Eine beeindruckende Erscheinung ist vor allem meine „Konkurrentin“ Alexandra Mitschke, die mit Scheibenrad, Hochprofil-Vorderrad und Aerohelm alle paar Runden an mir vorbeizieht. (Leider hatte ihr Angriff auf den Streckenrekord keinen Erfolg, denn sie musste nach der Hälfte des Rennens aufgeben.) Kein Zweifel, wenn ich nicht ganz hinten landen will, dann muss ich hoffen, dass die anderen größere Pausen einplanen und sollte selbst durchfahren, solange es geht. Denn schneller werde ich heute nicht mehr.

Der erste Teil des Anstiegs liegt zwar im Schatten, aber die Hitze macht mir ein bisschen zu schaffen. Beinahe alle zwei Runden brauche ich eine neue Flasche, ich versuche mich irgendwie von innen und außen herunterzukühlen. Nachdem ich vor dem Rennen nur ein paar Nudeln und ein Milchbrötchen runterbekommen habe, versuche ich gleich von Anfang an, stetig zu essen.
Die Abfahrt und die lange Gerade machen richtig Freude, wenn man (noch) Kraft hat. Also rausche ich wahlweise in Zeitfahr- oder Unterlenkerhaltung dahin und habe Spaß an der Geschwindigkeit. Da rächt sich, dass ich sonst im Training eher am Oberlenker dahingondele… denn mein Magen macht sich nach einigen Stunden bemerkbar. Die kompakte Körperhaltung auf den Speed-Abschnitten nimmt er mir übel und nach etwa 120 Kilometern muss ich mein Trikot ganz öffnen, um Druck vom Bauch zu nehmen. Unterlenker hat sich für den Rest des Rennens erledigt und mir ist ab jetzt immer etwas schlecht.

Nach neun Runden bzw. 150 Kilometern scheint mir der Zeitpunkt für eine erste Pause gekommen. An der Strecke riecht es jetzt zur Abendessen-Zeit überall nach herzhafter Brotzeit – und das will ich auch. Spätzle mit Bratensoße trage ich meinem besten Betreuer der Welt auf und als ich in unser Fahrerlager am alten Hafen einbiege, rieche ich schon das himmlische Fertigsoßen-Aroma. Warm und salzig – etwas Besseres kann ich mir gerade nicht vorstellen.
Die Nacht bricht an
Eine halbe Stunde gönne ich mir, um meine Spätzle zu spachteln und die Füße hoch zu legen. Dann schwinge ich mich wieder in den Sattel, diesmal ausgerüstet mit Licht und Warnweste, denn so langsam bricht die Nacht an.
Die Anstiege werden irgendwie länger und steiler, die Strategie wandelt sich von „da kann man schon mal hochschalten“ zu „größtes Ritzel rein und dann versuchen zu überleben“. Am Berg überhole ich wenn überhaupt nur noch den ältesten Teilnehmer Arthur Kink (Der wird bei jeder Zieldurchfahrt frenetisch gefeiert, zurecht mit seinen 84 Jahren!). Ansonsten versuche ich einfach voranzukommen, ohne stehenbleiben zu müssen.
Der Stausacker Berg macht mir unerwarterweise noch Freude in der Nacht – nicht, weil ich plötzlich so gut hochkommen würde. Nein, wirklich nicht. Aber die Kette aus roten Rücklichtern, die sich den Berg hinauf schlängelt, ist ein wunderbarer Anblick, bei dem ich den Schmerz beinahe kurz vergesse. Was mich den „Col de Stausacker“ außerdem immer wieder überleben lässt, sind die einfach unglaublichen Fans, die beinahe 24 Stunden Party machen und wirklich jeden anfeuern. Ganz großen Respekt dafür! Auch an anderen Punkten der Strecke haben immer wieder Anwohner sich einfach einen Campingstuhl an die Straße gestellt und feuern bis tief in die Nacht die Teilnehmer an.

Nur ein paar Minuten schlafen…
Die vierte Runde nach der ersten Pause wird zur Qual. Vor allem auf der Gerade zurück nach Kelheim fallen mir beinahe die Augen zu, die Straße scheint im Lichtkegel hin und wieder kurz zu flimmern. Glücklicherweise bin ich nicht in der Gruppe unterwegs. Ich will niemanden gefährden, so beschließe ich, nach insgesamt elf Stunden und 200 Kilometern noch einmal raus ins Lager zu fahren. Kurz die Augen schließen, das wäre jetzt paradiesisch.
Der beste Betreuer der Welt hat natürlich etwas Warmes für mich zu essen, einfach genial. Man lernt die kleinen Dinge zu schätzen. Die Campingliege zusammen mit der Kuscheldecke erscheinen mir wunderbarer als ein fluffiges Himmelbett, also fallen die Augen recht schnell zu. Nur ein paar Minuten…
„Wann willst Du denn weiter fahren?“, fragte der beste Sklaventreiber der Welt. „Gleich. Lass mich nur noch zehn Minuten liegen.“ – „Aber Du liegst da schon 20 Minuten.“ – „Ja ja, noch zehn Minuten.“ – – – „Du liegst da jetzt schon eine Dreiviertelstunde, willst Du irgendwann weiter fahren?“ – „Ja ja, noch zehn Minuten, ok?“ – „Nein, Du fährst jetzt. Du hast schließlich ein Ziel!“
Da hat er natürlich recht. Und ohne ihn würde ich wahrscheinlich einfach wochenlang liegen bleiben. Aber so streife ich vor Erschöpfung und Kälte zitternd die Kuscheldecke ab und werfe mich wieder in die Warnweste. Vier weitere Runden möchte ich ohne Pause überstehen, dann ist die Nacht schon fast wieder vorbei und ein Ende in Sicht, rede ich mir ein.
Erstmals bin ich froh, dass der Anstieg gleich zu Beginn der Runde ansteht. So werde ich nach wenigen hundert Metern wieder warm und wach. Um die Zeit in der Dunkelheit zu überbrücken, beginne ich zu rechnen. Ich habe noch etwas mehr als zwölf Stunden Zeit und möchte insgesamt 24 Runden schaffen. Das heißt, ich bin meinem Plan voraus, denn für dieses Ziel muss ich „nur noch“ elf Runden fahren. Mehr als eine Stunde Zeit pro Runde – das sollte doch zu schaffen sein!
Die Pause hat gut getan, ich fühle neue Lebensgeister in mir. Die Straße flimmert nicht mehr und ich schaffe es auch wieder, den nimmermüden Partygängern am Stausacker Berg zurückzulächeln. Der Berg erscheint zunächst nicht mehr ganz so schrecklich und ich kriege die nächtlichen Runden ganz passabel herum.

Der Sonnenaufgang und eine warme Dusche sorgen für neue Energie, aber die Anstiege werden irgendwie nicht leichter. Ich schummele hin und wieder und mache vor den steilsten Stellen eine kurze Pause, um ihnen den Schrecken zu nehmen. Ich suche nach Ausreden, um zumindest ganz kurz stehen zu bleiben.
Stop-and-go-Strategie
Irgendwann kann ich mir irgendwie so gar nicht mehr vorstellen, auch nur noch einmal die Anstiege in Angriff zu nehmen. Meine Rechenspiele allerdings motivieren mich: Vielleicht ist sogar noch eine Runde mehr drin als gedacht? Die Sonne steht wieder fast ganz oben am Himmel und ich entscheide mich für die „Weichei-Variante“: Jeweils zwei Runden fahren und dann eine halbe Stunde Pause. Denn die erste Runde klappt immer gut, die zweite klappt mit Pausen und über eine dritte Runde möchte ich gar nicht mehr nachdenken.

Ich fahre wie ferngesteuert meine Doppelrunden und versuche, nicht zu grübeln, was jetzt alles weh tut. Die recht enge Ein- und Ausfahrt der Wechselzone versuche ich von Anfang an zügig hinter mich zu bringen, damit ich niemanden behindere, der schnell vorbei möchte. Idioten gibt es aber leider überall und ein „Held“ versucht tatsächlich, sich bei der Ausfahrt neben mir durch das Stadttor zu zwängen. Spoiler: Das geht nicht. Ich sehe mich schon in den Gittern hängen, der andere besinnt sich glücklicherweise gerade noch, bleibt hinter mir und wir beide schimpfen wie die Rohrspatzen. Warum muss bei einem Hobbyrennen für zwei Sekunden Vorteil so riskant gefahren werden? Das gehört zu den Dingen, die ich in diesem Leben nicht mehr verstehen werde.

12 Uhr Mittag. Noch zwei Stunden für zwei Runden – das sollte doch zu schaffen sein! Meine Rundenzeiten sind inzwischen unterirdisch, deshalb versuche ich mich noch einmal am Riemen zu reißen in der vorletzten Runde. Je schneller ich die hinter mich bringe, desto gemütlicher wird die „Ehrenrunde“. Tatsächlich fahre ich nach einer Dreiviertelstunde wieder ins Ziel ein und habe damit noch 1 1/4 Stunden für die allerallerletzten 16 Kilometer.
Noch einmal hinauf. Ich mobilisiere letzte Kräfte, ignoriere alles, was schmerzt und pedaliere trotzig bergan. Bedanke und verabschiede mich (soweit es die Luft hergibt) bei allen, die die Strecke gesichert und den Straßenrand zur 24-Stunden-Partyzone gemacht haben. Sogar in moderatem Tempo tut die Gerade zurück Richtung Ziel jetzt weh, aber gleich ist es geschafft und irgendwie rollt das Rad doch weiter. Die letzten 500 Meter sind voll mit jubelnden Zuschauern. Nach 23 Stunden, 32 Minuten und 19 Sekunden fahre ich zum letzten Mal in die Wechselzone ein, die jetzt zum brodelnden Volksfest mutiert ist. Wahnsinn. 25 Runden, 409 Kilometer, 4.500 Höhenmeter – und doch noch der sechste Platz.
Erleichtert falle ich in die Arme des besten Betreuers der Welt und schwöre mir, sowas nie wieder zu machen. Zumindest für ein Jahr lang.
Carolyn Ott-Friesl
Seit fast 20 Jahren auf dem Rennrad unterwegs - nicht viel, nicht schnell, aber mit Leidenschaft. Seit 2014 Bloggerin auf Ciclista.net
Mehr über mich...
Meine Ausrüstung:
Helm* - Brille* - Bluetooth-Kopfhörer* - Radsportbekleidung* - Radsportcomputer*
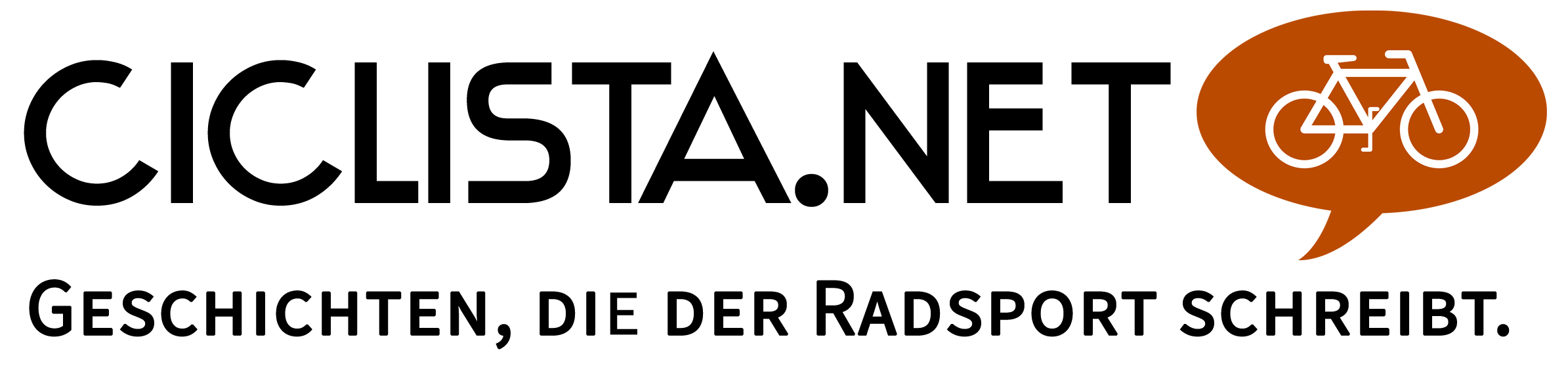





19 Gedanken zu “24-Stunden-Rennen Kelheim – der Rennbericht”
Bravo!
Meine liebe Carolyn,
ich ziehe meinen Helm und habe den größten Respekt vor Dir und Deiner Leistung!
Tolle Leistung! Ich könnte das nicht!
Liebe Grüße,
Beany
Carolina ich bin so stolz auf dich und dein Text ist grandios. Hut ab!!!
Gratulation und großen Respekt vor deiner Leistung !
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung! Sehr schön gemacht. Und auch sehr schön geschrieben 🙂
Ganz toller Bericht und eine super Leistung. Herzlichen Glückwunsch!
Herzlichen Glückwunsch Carolyn! Verdient ist verdient und du hast prima durchgehalten. Ich habe im September ähnliches vor und dein Bericht ist mir eine Motivation!
Alles Gute
Daniel
Wow, klasse Bericht eines grandiosen Rennens. Ich ziehe meinen Helm und alle Hüte, die ich finden kann!
Tolle Leistung, schöner Bericht. Danke dafür.
Soo.. Blog und twitter abonniert und deinen tollen Bericht zum 24h-Rennen gelesen.
Danke dafür und wie heute schon geschrieben, geh ich es nächstes Jahr an.
Weiterhin so schön zu lesende Blogbeiträge bitte!